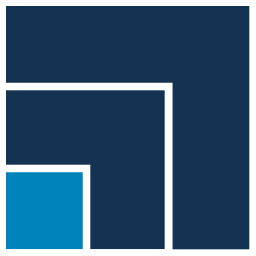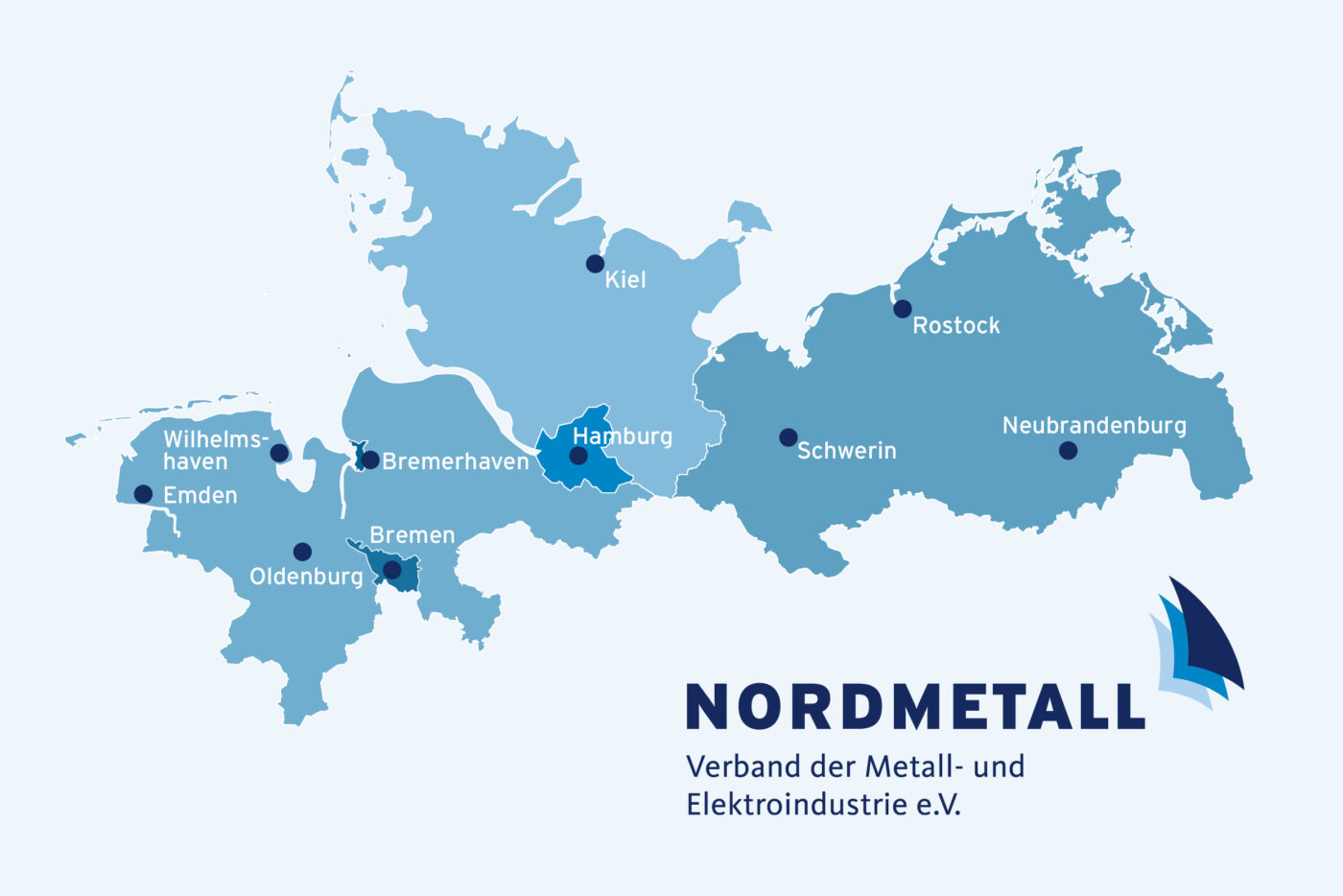Zurück zur Übersicht
Aktuelles aus dem Arbeitsrecht: Cannabislegalisierung
Worum geht es?
Seit dem 01.04.2024 ist Volljährigen in der Öffentlichkeit sowohl der Besitz als auch das Mitführen von bis zu 25 g getrocknetes Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt (vgl. § 3 Abs. 1 KCanG). Am eigenen Wohnsitz (also in der eigenen Wohnung) bzw. am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts darf eine erwachsene Person insgesamt 50 g getrocknetes Cannabis besitzen, sofern sie in Deutschland seit mindestens sechs Monaten einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (vgl. § 3 Abs. 2 i. V. m. § 1 Nr. 16 und 17 KCanG). Grundsätzlich ist damit auch der Konsum in der Öffentlichkeit erlaubt. Ausnahmen sind z.B. Schulen, Kinderspielplätze oder öffentliche Sportstätten. Zusätzlich gilt in Fußgängerzonen ein Konsumverbot zwischen 7 und 20 Uhr.
Sollten Sie in ihrem Unternehmen auf diese Regelung reagieren?
Grundsätzlich ist der Konsum am Arbeitsplatz (ausgenommen Schulen etc.) nicht nach dem KCanG verboten. Aber gem. § 15 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1 gilt: „Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden können.“ Gem. § 7 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1 dürfen Arbeitgeber:innen Beschäftigte, die erkennbar unter Cannabiseinfluss stehen, nicht arbeiten lassen. Bei konkreten Ausfallerscheinungen/ Störung der Arbeitsleistung durch den Konsum von Cannabisprodukten besteht eine Pflichtverletzung, die auch ohne Verbot geahndet werden kann.
Liegt jedoch keine konkrete Störung vor, fehlt es an einer Pflichtverletzung – besteht jedoch ein generelles betriebliches Rauschmittelverbot, kommt es darauf jedoch nicht an. Die Empfehlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ist daher ein ausdrückliches Verbot. Wie bereits beim Alkohol ist ein generelles Verbot des Konsums von Rauschmitteln anerkannt. Es unterfällt als Ordnungsverhalten und Gesundheitsschutz der Mitbestimmung des Betriebsrats gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 7 BetrVG (grds. örtlicher Betriebsrat).
Wie reagiere ich als Arbeitgeber:in auf den Konsum von Cannabis vor oder während der Arbeit?
Das hängt von der betriebsinternen Regelung ab: Denn ohne ein Verbot ist die konkrete Störung der Arbeitsleistung erforderlich, zum Beispiel durch konkrete Ausfallerscheinungen – allein der Konsum von Cannabis reicht nicht aus. Das Unternehmen ist in der Darlegungs- und Beweislast bzgl. der Störung der Arbeitsleistung. Existiert ein Verbot kommt es nicht auf die berauschende Wirkung des Konsums an, denn jeder Verstoß gegen das Konsum-, Rausch-, oder Mitführverbot ist eine Pflichtverletzung. Auch hier ist der/die Arbeitgeber:in darlegungs- und beweispflichtig.
Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen folgen daraus?
Sofern der Konsum nicht auf einer Sucht beruht, kann der Arbeitnehmer ohne Entgeltfortzahlung freigestellt werden. Er erhält ein Beschäftigungsverbot und wird unter Beachtung der Fürsorgepflicht nach Hause geschickt. Zudem könnte, je nach Schwere des Verstoßes und bei steuerbarem Verhalten, auch eine Ermahnung, Abmahnung oder personenbedingte (krankheitsbedingte) Kündigung folgen. Bei Personen mit einer Suchterkrankung müssen die drei Stufen einer krankheitsbedingten Kündigung vorliegen: Negative Gesundheitsprognose, erhebliche betriebliche Beeinträchtigungen und die Interessenabwägung (keine milderen Mittel wie z.B. Entziehungskur). Eine krankheitsbedingte Kündigung kann unter Umständen auch hilfsweise zur verhaltensbedingten Kündigung führen.
Wie lautet die Handlungsempfehlung?
Drogentests dürfen ohne Einwilligung der Arbeitnehmer:innen nicht durchgeführt werden. Auch mit Einwilligung dürfen Drogentests im Rahmen von Einstellungsuntersuchungen nur vorgenommen werden, wenn der/die Arbeitgeber:in hieran ein berechtigtes Interesse hat. Ein solches kann bei gefahrgeneigten Tätigkeiten (z.B. Arbeit an Maschinen) grundsätzlich zugesprochen werden. Außerdem kann in Eignungsuntersuchungen, zum Beispiel in einer Untersuchung der Fahr-Steuer- und Überwachungstätigkeiten durch einen Urintest der Cannabiskonsum bis zu 6 Wochen festgestellt werden. Damit existiert allerdings ein Abgrenzungsproblem: Wann wurde konsumiert und ist dies eine Pflichtverletzung? Diese Fragen sind noch nicht beantwortet. Da es also derzeit noch keine klaren Grenzwerte und ausreichend zuverlässige Test- und Nachweismöglichkeiten gibt, um den aktuellen Konsum nachzuweisen, ist es empfohlen, die bestehenden Betriebsvereinbarungen und Arbeitsanweisungen zum Rauschmittelverbot zu prüfen und ggf. zu ergänzen.